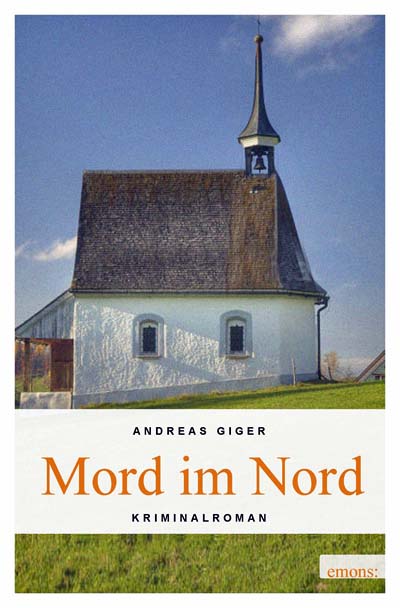Einzigartig wie das Appenzellerland:
Die Krimis von Andreas Giger

Das fünfte Buch
Franz Eugster stolpert vor einem brennenden Haus buchstäblich über die Leiche von Ferdinand von Muotathal. Sicher war es Brandstiftung, aber war es auch Mord? Von Muotathal war ein wichtiger Akteur bei den Jubiläumsfeierlichkeiten »500 Jahre Appenzell bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft«. Findet sich dort ein Motiv? Oder hat der Anschlag damit zu tun, dass das Opfer Mistel-Essenzen vertrieben hat? Oder gar mit einem unbekannten Appenzeller-Freiheits-Marsch von Richard Wagner? Zusammen mit der klugen Adelina löst Franz den Fall schließlich mit einem überraschenden Ende.
Ein Fall aus den Tiefen der Appenzeller Geschichte
Das sympathische Ermittlerduo Adelina und Franz Eugster taucht bei seinem neuen Fall tief in die Geschichte des Appenzellerlandes ein. Im Zentrum stehen die Jubiläumsfeierlichkeiten zum fünfhundertjährigen Beitritt des Landes Appenzell zur Eidgenossenschaft. Andreas Giger gelingt es, wie keinem zweiten Autor, die Historie und liebenswürdigen Eigenarten der Region in einer spannenden Krimihandlung aufgehen zu lassen. Dabei schreibt er mit spitzem, augenzwinkerndem Humor, der den packenden Plot harmonisch abrundet und das Buch zu einem äußerst kurzweiligen Lesevergnügen werden lässt.
Erstauflage: 2014, Emons-Verlag, Köln
Umfang: 160 Seiten
Preis: € 9.90
Das vierte Buch
Die bekannte Gartengestalterin Graziella Rosengarten wird erschossen in einem Appenzeller Landgasthof aufgefunden. Gleichzeitig wird die Zürcher Gartenbaufirma Spross erpresst. Was haben die beiden Fälle miteinander zu tun? Das bewährte Privatschnüfflerpaar Franz und Adelina macht sich auf die Suche nach Antworten, stösst dabei auf finstere Machenschaften der Hochfinanz und gerät selbst in tödliche Gefahr.
Märchenhaft heiter und haarscharf realistisch
In Rosenrot ist mausetot gelingt dem Autor Andreas Giger eine spannende Vermischung seiner Figuren mit denen aus einem bekannten Grimmschen Märchen. Daneben wird das Thema der kunstvollen Gartengestaltung wunderbar plastisch und anregend beschrieben und fügt sich gut in die Geschichte ein. Giger ist seinem lockeren Stil treu geblieben und schreibt klar und verständlich. Erneut schickt er das sympathische und ungleiche Ermittlerpaar Franz und Adelina auf Verbrecherjagd, das durch seine unkonventionelle Art dem Täter auf die Spur kommt. Ein vergnüglicher Appenzeller- Krimi, der bis nach Zürich führt.
Erstauflage: 2013, Emons-Verlag, Köln
Umfang: 144 Seiten
Preis: € 8.95
Probelesen
Das dritte Buch
Unterhalb des Säntis-Gipfels entdeckt Privatermittler Franz Eugster eine Gletscherleiche samt dem allerersten Appenzeller Käse. Kurz darauf sind Leiche und Käse verschwunden. Auf seiner Suche quer durchs Appenzellerland stößt Eugster auf allerhand skurrile Gestalten. Erst als schließlich ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte enthüllt wird, kommt es zum furiosen Finale.
Humorvoll, heiter und klug - der dritte Käse-Krimi aus dem Appenzellerland.
Besprechungen Erstauflage: 2013, Emons-Verlag, Köln
Umfang: 144 Seiten
Preis: € 8.95
Probelesen: Siehe unten
Bestellung
Leseprobe:
Leichenraub mit Eichenlaub
Vielleicht zweihundert Schritte unterhalb der Gletscherzunge, die ich schon gut sehen konnte, brauchte ich eine letzte kleine Rast. Ich setzte mich auf einen Stein, der mich irgendwie angezogen hatte, und sinnierte über eine Spalte zwischen zwei Steinen, die, wenn man mit dem Fuss blöd hineingeraten würde, zu einem ziemlich folgenschweren Sturz führen könnte.
Wie Adelina auch schon festgestellt hatte, übten solche Katastrophenszenarios eine gewisse Faszination auf mich aus. Dazu kam, dass ich selbst mal einen solchen saublöden Sturz erlebt hatte, der einen Knochenbruch verursachte. Und doch gab es eigentlich keinen Grund für die plastischen Bilder vom Sturz eines mir fremden Menschen an genau diesem Ort, die sich jetzt mit Macht in meinem Kopf ausbreiteten.
Plötzlich spielte auch noch mein Gehör verrückt. Mir war nämlich, als ob ich wieder den Song hören würde, der mich vor Kurzem noch so beschäftigt hatte. Nicht wirklich natürlich, ausser dem Refrain waren die Worte nicht zu verstehen, und auch die Musik klang irgendwie fremdartig, doch die Gefühle, die ich verspürte, waren exakt dieselben wie beim Hören von Adeles Lied. Allerdings kam die Musik nicht aus meinem Kopf, sondern von oben, vom Blau Schnee her.
Nun glaube ich zwar durchaus an die grundsätzliche Existenz von Dingen zwischen Himmel und Erde, die wir noch nicht verstehen, doch an platte esoterische Phänomene wie fremde Stimmen in meinem Kopf habe ich nie geglaubt, geschweige denn, dass ich so etwas wie eine Geistererscheinung schon selbst erlebt hätte. Jetzt allerdings bekam ich doch meine Zweifel, zumal die Frauenstimme, die ich hörte, unzweifelhaft nicht aus einem leibhaftigen Lautsprecher oder gar einem lebendigen Leib kommen konnte, dafür war sie viel zu fein- stofflich, und auf einer Mikrofonaufnahme hätte man sicher nichts gehört.
Die Stimme war da, in meinem Kopf, wenn sie auch unbestreitbar von anderswoher stammte. Es war auch eindeutig nicht die Stimme von Adele, auch wenn sie dieselben Gefühle ausdrückte, die Gefühle einer verzweifelten verlassenen Frau. Nur das abschliessende «Wann werden wir uns wiedersehen?» trug noch stärker als bei Adele die Gewissheit einer Antwort in sich: nie mehr.
Die Stimme in meinem Kopf übte einen unwiderstehlichen Sog auf mich aus, sodass ich die letzten Meter hinauf zu jenem Punkt am unteren Gletscherrand, zu dem sie mich zog, fast rannte. Doch als ich schwitzend und keuchend oben ankam, war sie verstummt. Dafür entdeckten meine herumschweifen- den Augen bald etwas Ungewöhnliches: Aus dem Eis des Blau Schnees ragte, knapp oberhalb des Felsengrunds, ein Schuh. Und darin steckte ein Fuss.
Der extrem heisse Sommer war auch am Blau Schnee nicht spurlos vorbeigegangen. Firn- und Eisreste zeugten davon, dass sich der Gletscher in den vergangenen Wochen um etliche Meter zurückgezogen hatte. Neben dem Schuh sah ich den Anfang eines überhängenden Felsens, unter dessen Vorsprung sich ein bläulich schimmernder Block aus blankem Eis ab- zeichnete, der allerdings für mein Auge undurchdringlich blieb.
Doch dann erreichte die Sonne am wolkenlosen septemberblauen Himmel einen Punkt, von dem aus ihre Strahlen genau im richtigen Winkel auf diesen Eisblock trafen, um ihn durchsichtig zu machen. So konnte ich sehen, dass zu dem aus dem Eis ragenden Fuss ein ganzer in den Eisblock eingeschlossener Mensch gehörte.
Und dieser Mensch war unverkennbar eine Frau. Das sah ich nicht nur an ihrer Bekleidung, sondern auch an ihrem Gesicht, das fast unversehrt erschien, was auch für den restlichen Körper galt, soweit ich das beurteilen konnte. Sie lag auf dem rücken, die Hände im Schoss gefaltet. Nur der aus dem Eis ragende Fuss erschien mir unnatürlich verdreht.
Bei näherer Betrachtung fiel mir noch etwas auf. Selbst mir als unverbesserlichem Mode-Banausen war klar, dass Schuhe und Bekleidung nicht aus unserer Zeit stammen konnten. Obwohl ich keine Ahnung davon hatte, was man wann getragen hatte, schätzte ich mal, dass die Gletscherleiche schon mindestens zweihundert Jahre da oben gelegen haben müsste. Womit ich ziemlich danebenlag.
Für historische Überlegungen hatte ich jetzt ohnehin keine Zeit. Ich nutzte den günstigen Sonnenstand, um mit meinem neuen iPhone einige Fotos aufzunehmen, und rief dann meinen alten Kumpel Karl Abderhalden, Chef der Appenzell Ausserrhoder Kriminalpolizei, auf seinem privaten Handy an.
* * * *
Nur eine gute Stunde dauerte es, bis ich die unverkennbaren Geräusche eines sich nähernden Helikopters hörte. Karl hatte ganze Arbeit geleistet und nicht nur das zuständige Team organisiert, sondern zudem auch noch die bequemste Transportmöglichkeit. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst dabei zu sein, und kletterte nun als Erster aus dem Helikopter, der nicht allzu weit weg von meiner Position einen Landeplatz gefunden hatte.
Das Trüppchen, das sich nun rasch näherte, umfasste al- les, was dazugehört: Zwei Männer von der Rettungskolonne Appenzell, die Kantonsärztin, einen Spurensicherer, zwei Polizisten in Uniform und den innerrhodischen Polizeichef, also den Amtskollegen von Karl. Der Amtsschimmel musste galoppieren, auch wenn es in diesem Fall wenig zu retten und zu ermitteln gab.
Bevor ich dem Trupp ein paar Schritte entgegenging, verstaute ich mein iPhone und meine Pocketkamera in den Hosentaschen. Ich wollte niemanden auf die Idee bringen, dass ich schon diverse Aufnahmen von der Gletscherleiche gemacht hatte. Ich war in der Wartezeit nicht untätig geblieben und hatte mit meiner Kamera, die ich wie immer ebenfalls dabeihatte, die Sonnenstrahlen genutzt, welche die Frau im Eis ideal ausleuchteten. Ich hatte sogar mit meinen Schuhspitzen einige Tritte in den nahen Firnabbruch gegraben und war hinaufgeklettert, um ein paar Aufnahmen von oben machen zu können.
Da ich einen wackligen Stand hatte, konnte ich nicht mehr als drei Fotos machen, und zwei davon waren tatsächlich verwackelt, wie ich bei der folgenden Sichtung feststellen musste. Doch das dritte war perfekt. Man konnte darauf die Tote im Eis von schräg oben sehen, weitgehend klar, eingehüllt nur von einem sanften bläulichen Schimmer. Kein Modefotograf hätte eine bessere Inszenierung von Schneewittchen im Eissarg hinbekommen.
Apropos Mode: Jetzt, wo ich auf dem Bild mehr sah als zuvor in der Realität, wurde sogar mir Laien klar, dass die Kleidermode noch älter sein musste, als ich zuerst geschätzt hatte. Doch die Mode interessierte mich im Moment weniger. Vielmehr zoomte ich auf dem Bildschirm meiner Kamera das Gesicht näher heran. Und weil ich eben an Schneewittchen gedacht hatte, fiel mir jetzt nur ein vergleichbares Gesicht ein: jenes der Mona Lisa.
Auch dieses Gesicht war nicht unbedingt im landläufigen Sinne schön, doch ungemein ausdrucksvoll. Und auch in diesem nur angedeuteten Lächeln steckte ein Rätsel, eine Mischung aus Trauer und Frieden, aus Bitterkeit und Versöhnung. Einen Unterschied zu Mona Lisa und Schneewittchen allerdings gab es: Hier lag ein Mensch aus Fleisch und Blut, wenngleich seit langer Zeit tot, konserviert in Eis, das sich zu guter Letzt doch als nicht ewig erwiesen hatte.
Noch einmal betrachtete ich das Bild, von dem ich schon wusste, dass es sehr gut war, aber noch nicht ahnte, dass es zur Ikone werden würde, und entdeckte hinter dem Kopf der Frau ein zunächst unidentifizierbares Objekt. Doch auch hier half Zoomen: Beim Objekt handelte es sich ohne Zweifel um einen runden Käselaib.
Adelina hatte die Wartezeit genutzt, um schon mal nach Bildern und Berichten von Gletscherleichen zu googeln, und dabei nichts Vergleichbares gefunden. Ötzi war zwar viel älter, aber doch ziemlich eingeschrumpelt. In der Schweiz hatte es in der Nähe des Piz Kesch im Kanton Graubünden schon einmal einen spektakulären Fund einer Gletscherleiche aus dem 17. Jahrhundert gegeben – übrigens auch eine Frau –, doch auch deren Zustand war mit dem meines Fundes nicht annähernd zu vergleichen.
Bevor wir in unseren gemeinsamen Schlafsack krochen, um mit der Hingabe an das Leben die Gedanken an Leichen aller Art zu verscheuchen, unterhielten wir uns noch darüber, welchen Namen die Tote vom Blau Schnee wohl erhalten würde. Da sich einmal in die Welt gekommene Muster hartnäckig halten, waren wir uns bald einig, dass sie, so wie Ötzi kurz und bündig nach der Region seines Fundortes genannt wurde, als Appenzellerin wohl unvermeidlich «Appi» heissen würde.
* * * * *
Damit fehlte nach wie vor jeder konkrete Hinweis darauf, was Appi da oben am Blau Schnee zu suchen gehabt hatte.
Mit einer Ausnahme: Sie hatte ja einen Käselaib dabei, den sie auf einem eigens dafür konstruierten Holzgestell, das heute als «Räf» bezeichnet wird, auf dem Rücken mitgetragen haben musste. Und über diesen Käse gab es Bemerkenswertes zu berichten. Die lebensmittelchemischen Analysen hatten nämlich ergeben, dass seine Zusammensetzung jener des heutigen Appenzeller Käses bis aufs Haar glich. Es gab auch eindeutige Hinweise darauf, dass der Käselaib regelmässig mit einer Kräutersulz eingerieben worden war.
Nach harten Verhandlungen hatte es die Sortenorganisation Appenzeller Käse geschafft, einige kleine Stücke für einen Geschmackstest zu beschaffen. Der Käse war einwandfrei konserviert, sodass es keine Einwände dagegen gab, dass einige versierte Testpersonen, die schon aus einem winzigen Biss den Geschmack herausspüren können, einen solchen Praxistest machten. Ergebnis: Man könnte diesen siebenhundert Jahre alten Käse zur Not als gut gereiften, wenngleich wegen allzu langer Lagerzeit etwas geschmacklos gewordenen Appenzeller verkaufen – als ersten Appenzeller Käse der Welt sozusagen.
Was natürlich niemand vorhatte. Vielmehr wurde in der Medienkonferenz auch darüber informiert, wie es nun weitergehen sollte. Erst einmal würde Appi mitsamt ihrem Käse in die ebenfalls in St. Gallen angesiedelte EMPA (Eidgenössische Materialprüfungsanstalt) gebracht, wo man mit Hilfe von Hightechmethoden weitere Untersuchungen anstellen wollte. Derweil würde man mit Hochdruck an der Suche für einen würdigen Ausstellungsort arbeiten, wo Appi und ihr Käse möglichst bald einem interessierten Publikum zugänglich gemacht werden sollten.
In der anschliessenden Fragenrunde wurde noch einmal heftig darüber spekuliert, was Appi wohl mit dem Käse da oben gewollt habe. Die Historikerin erklärte, die Landwirtschaft sei damals fast vollständig auf Eigenversorgung beschränkt gewesen, doch sei es durchaus denkbar, dass ein gewitzter Käseproduzent, der in diesem Fall wohl eine Käseproduzentin gewesen sei, etwas über den Eigenbedarf hinaus hergestellt habe, um es dann zu verkaufen.
Da kaum anzunehmen sei, dass Appi auf dem Säntisgipfel einen Käufer finden wollte, käme eigentlich nur eine Direktüberschreitung hinüber in Richtung Schwägalp in Frage. Dort sei eine frühe Käseherstellung in beträchtlichem Umfang nachweisbar. Wohl sei die Route, die Appi dafür gewählt habe, nicht unbedingt die naheliegendste, aber eine für eine gewandte Berggängerin durchaus mögliche. Wem sie den Käse bringen wollte, bleibe natürlich ungeklärt. Möglicherweise einem Senn, der zusammen mit seinem eigenen Käse auch fremden in Kommission verkaufte, oder vielleicht auch einem fahrenden Händler.
Die lokalpatriotische Regionalpresse bezeichnete Appi am nächsten Tag denn auch flugs als Erfinderin des Appenzeller Käses, die darüber hinaus offenbar auch noch Verkaufstalent gehabt habe. Mit dieser Mischung aus einem einmaligen Produkt und einer gewitzten Vermarktungsstrategie sei sie bis heute Vorbild. Und auch sonst konnten sich die Marketing- Verantwortlichen von der Sortenorganisation Appenzeller Käse nicht über mangelnde Publizität beklagen. Die Kombination aus schöner Gletscherleiche und einem vollständig erhaltenen und im wahrsten Sinne urwüchsigen Naturprodukt war für kurze Zeit ein Medienereignis erster Güte.
Dann schwand das öffentliche Interesse rapide. Das lag nicht zuletzt daran, dass es mit Ausnahme des mittlerweile sattsam bekannten meinigen keine wirklich guten Bilder von Appi gab. Die Gnade des richtigen Moments mit exakt dem idealen Licht, der ich meine Aufnahme verdankte, hatte sich nicht wiederholt, und im Untersuchungslabor liess sich diese Magie des Augenblicks ebenfalls nicht wiederherstellen.
So sah denn keine Redaktion einen Grund, nochmals auf das Thema Appi zurückzukommen. Bis zu jenem Tag etwa zwei Wochen nach der Medienkonferenz, als der «Blick» in riesigen Lettern verkündete: «Appi entführt!»
Das zweite Buch
Das Bewahrungskomitee für das geheime Appenzeller-Kräutersulz-Rezept verkostet einen Käse, der ein geradezu rauschhaftes Gefühl auslöst. Es stellt sich heraus, dass der Effekt auf das jahrhundertealte, streng gehütete Kräuterbitter- Rezept eines Mönchs zurückgeht. Doch wie kommt der Käse zu dieser Wirkung – und was hat der gewaltsame Tod eines Sonderlings im abgelegenen Nord damit zu tun. Eine hochspannende Story um Appenzeller Geschichten und Skurrilitäten, Mythen und Geheimnisse.
Erstauflage: 2013, Emons-Verlag, Köln
Umfang: 144 Seiten
Preis: € 8.95
Probelesen: Siehe unten
Bestellung
Leseprobe:
Mord im Nord
Zunächst schlug ich jedoch eine Stärkung vor. Ich holte ein sorgsam gehütetes grösseres Stück Appenzeller Käse aus dem Kühlschrank, schnitt davon zwei Portionen von je ungefähr fünfzig Gramm ab, und servierte den Käse ohne weitere Beilagen. Ich schlug vor, den vorgesehenen Wein später zu trinken. Adelina schaute darob leicht erstaunt, doch sie kaute brav ihren Appenzeller, der ihr, wie sie versicherte, wie immer hervorragend schmecke.
Wir plauderten eine ganze Zeit über dieses und jenes, ohne das heikle Thema Soma zu streifen. Nach einer knappen Stunde fragte ich Adelina ganz harmlos, wie sie sich fühle. Sie horchte eine Weile in sich hinein und sagte dann, sie wisse natürlich, dass ihre Wortwahl vom letzten Willen von Hans Bärlocher beeinflusst worden sei, doch sie finde tatsächlich kein besseres Wort für ihre Empfindungen als Seelenfrieden. Das sei doch eher überraschend, sei sie doch bisher wegen meiner Geheimniskrämerei aufgeregt und verärgert und angespannt gewesen, doch jetzt erfülle, nach einer kurzen Übergangszeit, tatsächlich Frieden ihre Seele.
Normalerweise daure das bei ihr viel länger. Ein Glas Wein oder ein Pfeifchen könnten diesen Entspannungsprozess erleichtern und beschleunigen, aber beides, stellte sie richtigerweise fest, hätten wir ja heute noch nicht gehabt. Dennoch fühle sich ihr jetziger Bewusstseinszustand an, als ob sie etwas genommen hätte. Sie habe ja einige Erfahrungen mit durch Moleküle veränderten Bewusstseinszuständen und könne das deswegen beurteilen. Allerdings gleiche ihr jetziger Zustand keiner ihrer Erfahrungen. Sehr sanft und subtil fühle es sich an, klar und einfach, gelassen und souverän, fried- und freudvoll. Ja, Seelenfrieden sei wirklich ein gutes Wort dafür.
Sie schwieg eine Weile, blickte mich dann fragend an und begehrte zu wissen, ob ich ihr nicht doch vielleicht heimlich etwas verabreicht hätte. Ich schwieg vielsagend. Adelinas Blick wanderte umher, um schliesslich an den Rindenresten unserer Käsemahlzeit hängen zu bleiben. Ein Ausdruck ungläubigen Staunens erschien auf ihrem Gesicht. Sie brauchte offenbar eine Weile, um die Erkenntnis zu verdauen. Ob es wirklich der Käse gewesen sei, wollte sie wissen. Meine Antwort bestand aus einem einzigen Wort: ja.
Ein Stück Appenzeller Käse, das nicht nur hervorragend schmeckt, sondern auch Seelenfrieden schenkt – Adelina konnte es noch immer nicht fassen. Ich versprach, ihr gleich mehr darüber zu berichten. Zunächst kramte ich eine blaue Klarsichthülle aus dem Stapel, in dem ich Material über Käse sammle, um ihr zu zeigen, dass die Idee auch grundsätzlich nicht so abwegig war, wie sie zunächst klang.
Der erste Zeitungsausschnitt berichtete unter dem Titel »Käse ist weltweit beliebtestes Diebesgut bei Lebensmitteln« darüber, dass 2011 der Käse das Frischfleisch vom Spitzenplatz auf der Hitliste der weltweit meistgeklauten Lebensmittel verdrängt habe, was doch eindeutig darauf hindeutet, dass Käse ein ganz besonderes Lebens-Mittel ist.
Der zweite Ausschnitt war eine Buchbesprechung, die wie folgt eingeleitet wurde: »Der amerikanische Journalist James Nestor liefert schräge Ideen für hundertfünfundsiebzig Räusche ohne Drogen.« Gelb markiert hatte ich mir in diesem Artikel den folgenden Satz: »Und zum Glück liefert Nestor einige richtig schräge Ideen: Sich freiwillig auf Schlafentzug setzen« – und jetzt kam es – »vor dem Zubettgehen stets Käse essen!« Mehr Details standen da leider nicht, und ich hatte mir das Buch auch nicht besorgt, doch der Zusammenhang zwischen »Rausch ohne Drogen« und »Käse« war offenkundig hergestellt.
Auf einem Zettel fand sich ein Zitat aus einer Radiowerbung eines deutschen Senders, den der Fahrer eines Postautos, in dem ich irgendwann sass, eingestellt hatte: »Natürlicher Genuss mit Wirkung!« Dieser Slogan bezog sich zwar auf ein mir unbekanntes Mineralwasser, doch er war ein deutliches Indiz dafür, dass der Gedanke, natürliche Lebensmittel wie Wasser oder eben auch Käse könnten mehr bewirken, als Hunger und Durst zu stillen, durchaus in der Luft lag.
Im Mäppchen war noch ein Zettel mit der Web-Adresse von Gruyère-Käse, also einer direkten Konkurrenz von Appenzeller Käse. Ich rief die entsprechende Seite auf, auf der man den aktuellen Fernsehspot anschauen konnte. In diesem kommt ein völlig überdrehter Mountainbike-Fahrer nach einer aufregenden Abfahrt in der Alphütte an und berichtet dort einem völlig ruhigen jungen Mann unter grossem Fuchteln und Zappeln von seinen Erlebnissen. Nachdem er eine Weile zugehört hat, greift der junge Mann zu einem Stück Käse und bietet es dem Zappelphilipp mit den Worten »Probier das. Dann wird's besser!« an. Der ob seiner Überdrehtheit mittlerweile zusammengebrochene Biker isst einige Bissen Gruyère, sagte dann: »Geht besser!«, und beruhigt sich in Sekundenbruchteilen total. Im Abspann verkündet eine Stimme aus dem Off: »Die wahre Natur beruhigt.« Viel direkter konnte die Aufforderung, ein Stück Käse als Psychopharmakon zu nutzen, wohl kaum formuliert werden.
Adelina musste zugeben, die Idee, ein Stück Käse könne Seelenfrieden bringen, sei wohl doch weniger abwegig, als sie zunächst gedacht hätte. Umso mehr brannte sie darauf, jetzt endlich die Geschichte von jenem Käse zu hören, den mittlerweile alle Eingeweihten nur noch »Appenzeller Secret« nannte. Nachdem wir uns endlich ein Glas Wein und so gegönnt hatten, legte ich los.
Davon, dass ich kurz nach meinem ersten Fall auf verschlungenen Pfaden ins streng geheime Bewahrungskomitee für das Geheimrezept von Appenzeller Käse berufen worden war, hatte ich Adelina schon erzählt. Und genau dort begann vor einigen Monaten die Geschichte von »Appenzeller Secret«. Es war erst die zweite rituelle Versammlung des Bewahrungskomitees, an der ich teilnahm. Zunächst wurde nach dem bewährten Verfahren, das keinem der Beteiligten die volle Kenntnis des Geheimrezepts erlaubt, die übliche Menge Kräutersulz produziert, die bekanntlich dem Appenzeller Käse den unvergleichlichen Geschmack gibt, weshalb ihr Rezept unbedingt geheim gehalten werden muss.
Das Ritual verlief ebenso feierlich und würdevoll, wie ich es beim ersten Mal kennengelernt hatte. Gegen Ende lockerte sich die Stimmung naturgemäss etwas auf, weil es ja zum Ritual gehörte, dass jede Runde des Produktionsprozesses mit einem Schluck Appenzeller Alpenbitter gekrönt wird. Da das Bewahrungskomitee aus sieben gestandenen Mannsbildern besteht, die alle ordentlich was vertragen, konnte man die Runde als höchstens ganz leicht angeheitert bezeichnen.
Das kleine Detail, wonach das Bewahrungskomitee traditionsgemäss ausschliesslich aus Männern besteht und damit wohl eines der letzten solchen Gremien ausserhalb des Vatikans ist, hatte ich Adelina bisher verschwiegen. Sie regte sich einen Moment lang fürchterlich darüber auf, doch da der Appenzeller Secret noch nachwirkte und sie neugierig auf den Fortgang der Geschichte war, beruhigte sie sich rasch und hörte wieder zu.
Die unverrückbare Tagesordnung des Bewahrungskomitees sieht vor, dass nach der Produktion der neuen Kräutersulz das Ergebnis einer früheren Produktion getestet wird. Konkret wird von jenem Käse gekostet, der mit der Kräutersulz aus der vorletzten Versammlung des geheimen Komitees eingerieben worden ist. Um das Geschmacksurteil nicht durch einen zu hohen Alkoholpegel zu trüben, wird eine Stunde lang nur Wasser ausgeschenkt, wobei es sich selbstverständlich um Appenzeller Mineralwasser aus dem nahen Gontenbad handelt. Sonst gibt es während dieser Stunde vor dem feierlichen Abschluss des rituellen Abends keine Vorschriften. Die Mitglieder des Bewahrungskomitees plaudern deshalb in dieser Zeit über dieses und jenes und nutzen sie zu dem, was man neumodisch »Networking« nennt.
Die Stunde war fast vorbei, als ein Mitglied des Bewahrungskomitees um allgemeine Aufmerksamkeit bat. Der Name tut hier nichts zur Sache und muss natürlich geheim bleiben, also nennen wir ihn einfach mal Heiri. Heiri, ein Umweltschützer und Grüner der ersten Stunde, war mittlerweile in Ehren ergraut, was man seinem zotteligen Vollbart deutlich ansah. Er geht sommers wie winters barfuss, hatte sich auch mal politisch betätigt und ist mittlerweile ein anerkannter Experte für intelligente Energiekonzepte geworden. In das Bewahrungskomitee war er wie ich über das zweistufige Verfahren aus zufälliger und gezielter Auswahl gekommen und er ist dort ein leuchtendes Beispiel für die weise Unvoreingenommenheit bei der Erneuerung dieses Geheimbundes.
Heiri jedenfalls sagte in die entstandene Stille hinein, er habe ja bekannterweise früher so manchen Joint geraucht und so manches Pilzsüppchen gelöffelt und verfüge deshalb über einschlägige Erfahrungen. Die würden ihm sagen, dass er sich im Moment eindeutig auf einem kleinen Trip befände. Am Alkohol könne es nicht liegen, sie hätten ja eine Stunde lang nichts getrunken, und die beschriebene Wirkung habe erst vor Kurzem angefangen. Ob es den anderen auch so ginge?
Der zweite, der das Wort ergriff, war Moritz – auch das natürlich nicht sein richtiger Name. Auch er trägt einen Vollbart, ist aber sonst das Gegenstück zu Heiri, ein äusserst traditionsbewusster Milchbauer, der sich selbst, und den andere, eindeutig dem konservativen Lager zuordnen. Moritz äusserte sich dahingehend, dass er sich sehr wohl auch etwas »räuschelig« fühle, wie er sich ausdrückte.
Es reihten sich nach und nach auch die anderen in den Chor jener ein, die von einer deutlich wahrnehmbaren Veränderung des Gemüts zu berichten wussten. Ich selbst hütete mich, auf eigene Erfahrungen mit veränderten Bewusstseinszuständen zu verweisen, da ich nicht wusste, ob ich mit ebenso viel Toleranz rechnen durfte wie Heiri. Doch als ich sagte, auch ich spüre eine deutlich wahrnehmbare Veränderung meines geistig-seelischen Grundzustands, und zwar eine sehr angenehme, entsprach dies der Wahrheit.
Die anderen berichteten jetzt ausnahmslos, es handle sich um eine zwar unerwartete und deshalb etwas seltsame Erfahrung, doch eindeutig um eine positive. Zu deren Beschreibung verwendeten sie ganz ähnliche Worte, wie sie Adelina eben benutzt hatte. Heiri, der sich im Laufe seines langen Lebens auch intensiv mit Theologie und Psychologie befasst hatte, war es schliesslich, der die Erfahrung auf den Punkt brachte: Seelenfrieden. Niemand fand ein besseres Wort für die eben gemachte Erfahrung, die nach etwa einer halben Stunde sanft ausklang.
Das erste Buch
Ein Buch über Appenzeller Geheimnisse soll der abgehalfterte Lokaljournalist Franz Eugster aus dem Appenzeller Vorderland schreiben – und dann stolpert er über eine Leiche in der Bleiche. Wie er mit gütiger Mithilfe von Temporärfreundin Adelina und Kater Grizzly schließlich die Geheimnisse um das jähe Ende eines kommenden Königs von Appenzell enträtselt und dabei Land, Leuten und Wesen des seltsamen Landstrichs Appenzell näher kommt, schildert dieser vergnügliche erste Appenzeller-Käse-Krimi der Welt.
Neuauflage: 2012, Emons-Verlag, Köln
Umfang: 128 Seiten
Preis: € 8.95
Probelesen: Siehe unten
Bestellung
Leseprobe:
Eine Leiche in der Bleiche
Vorbemerkung: Ich mache diese Aufzeichnungen aus alter Gewohnheit als früherer Lokalreporter. Damals habe ich ein Gespür für Geschichten entwickelt, aus denen was werden könnte, und war dann jeweils froh um das schon aufgeschriebene Material. Und aus dieser Geschichte könnte definitiv etwas werden... Gleichzeitig muss ich mich und allfällige andere Leser warnen: Es könnte sein, dass in diesen Notizen sich gelegentlich meine Neigung durchsetzt, ins Plaudern und ins Dozieren zu kommen. Ich bitte mich und die anderen zum Voraus um Nachsicht.
Montag, 18. April
Der Polizeibeamte, den sie zu dieser für einen Bürobetrieb späten Stunde deutlich nach Feierabend entbehren konnten und deswegen zum Fundort geschickt hatten, war ein junger Schnösel. Nassforsch und völlig von sich und seiner eigenen Intelligenz überzeugt, obwohl es durchaus Gründe gegeben hätte, an letzterer leise zu zweifeln. Was er aus meiner Zeugenaussage in seinem Rapport gemacht hat, weiß ich noch nicht, das werde ich morgen erfahren, wenn ich nach Trogen auf den Polizeiposten gehe, um das Protokoll zu unterschreiben. Für den Moment schreibe ich aus dem Gedächtnis auf, wie ich diese Einvernahme erlebt habe.
Polizist: »Sie haben also die Leiche gefunden.«
Ich: »Ja.«
»Ihr Name?«
»Eugster.«
»Vorname?«
»Franz.«
»Jahrgang?«
»1953.«
»Wohnhaft?«
»In Wald, Tanne 333.«
»Beruf?«
»Journalist.«
»Arbeitgeber?«
»Ich arbeite selbständig als freier Journalist.«
»So, so... Dann erzählen Sie mal. Was haben Sie eigentlich da unten gesucht?«
Mit „da unten“ meinte er das Bachbett unterhalb der Brücke, die an der tiefsten Stelle der Straße zwischen Trogen und Wald die Goldach überquert. Und da zwischen Strasse und Bachbett geschätzte zwölf Meter liegen, war die Frage durchaus berechtigt. Ich räusperte mich und hub zu einer längeren Erklärung an:
»Ja, also, ich arbeite zurzeit an einem Buch, das im weitesten Sinne mit dem Appenzellerland zu tun hat. In erster Linie schreibe ich die Texte, aber weil ich ein leidlich begabter Amateurphotograph bin, der einen ganz guten Blick für stimmige Bilder hat, kundschafte ich auch aus, von welchen Standorten aus die Profiphotographen später am besten ihre Bilder machen. Dafür streife ich gelegentlich plan- und ziellos durch die Gegend und lasse mich vom Augenblick inspirieren.«
Der Polizist blickte jetzt ziemlich skeptisch. So eine anarchistische Arbeitsweise schien ihm noch nie begegnet zu sein. Unbeeindruckt fuhr ich fort:
»Ich ging also von Wald den direkten Weg durch die Wiese in Richtung Bleichi runter...«
»Moment, wohin?«
Der junge Mann schien noch nicht sehr lange in der Gegend zu arbeiten, sonst hätte er gewusst, dass „Bleichi“ das ganze Gebiet westlich der erwähnten Brücke heißt. Ich erläuterte es ihm auf der Karte, die ich bei solchen Streifzügen immer dabei habe. Das gab mir gleichzeitig Gelegenheit, dem Polizisten auf der Karte auch den kleinen Fußweg zu zeigen, der zur Bleichimüli unten am Bach führt, denn da wollte ich eigentlich hin.
»Dann«, so nahm ich den Faden wieder auf, »habe ich da oben am Waldrand zwei Kälber gesehen, ein schwarzes und ein weiß-rot geflecktes, die zusammen ein prächtiges Bild abgaben. Ich wollte näher ran und bin deshalb vom Weg abgewichen. Die Kälber tummelten sich an einem ziemlich steilen Abhang. Ich schlich mich vorsichtig an, und es gelang mir, mit meiner kleinen Kamera ein paar Bilder aufzunehmen, die mir ein gutes Gefühl gaben.«
Der Polizist murmelte ungeduldig: »Kommen Sie zur Sache!«
»Bin ja schon dabei. Jedenfalls bin ich dann einen Moment unachtsam gewesen und mit einem Fuß in eines dieser Huflöcher geraten – Sie wissen schon, jene Löcher die es in jedem Wiesenhang gibt, auf dem häufig Kühe weiden. Das hat mich zum Stolpern gebracht. Ich konnte mich zwar wieder auffangen, doch dabei ist mir die Kamera aus der Hand geglitten und den Abhang hinunter gekullert. Ich sah ihr fluchend nach, doch dann verfing sie sich ein ganzes Stück weiter unten in einem Gebüsch. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihr nachzuklettern.
Das habe ich gemacht und die Kamera auch gefunden. Sie war etwas verbeult und hatte Schmutzflecken, doch zum Glück funktionierte sie noch. Nun stand ich vor der Entscheidung, wieder hochzuklettern oder den Abstieg fortzusetzen. Ich konsultierte meine Karte und stellte fest, dass der Bach, der weiter unten leise rauschte, kurz unterhalb der Brücke in der Bleichi in die Goldach münden würde. An jener Stelle war ich auf einem meiner Streifzüge schon mal gewesen, und wusste deshalb, dass ich dort problemlos wieder raus käme. Ich brauchte also nur zum Bach abzusteigen und diesem dann abwärts zu folgen.
Das erwies sich als ziemlich anstrengend und nicht ganz ungefährlich. Ich weiß, dass ich auch Glück hatte. Wegen des außergewöhnlich trockenen Frühlings führt der Bach nicht viel Wasser. So konnte ich ihn an manchen Stellen problemlos überqueren, was auch nötig war, denn an den Außenseiten der Kurven, die der Bach beschreibt, fällt der Abhang extrem steil direkt bis zum Bach ab, nur auf den Innenseiten hat man eine Chance zum Weiterkommen. Item, ich habe es dann doch geschafft. Irgendwo bin ich allerdings noch einmal in ein Loch getreten, dass trotz der Trockenheit schlammgefüllt war, und habe mir dabei buchstäblich einen Schuh voll heraus gezogen.«
Erst jetzt bemerkte der Polizist meinen schlammverkrusteten einen Schuh und das Hosenbein, das bis zum Knöchel arg verschmutzt war. Dass meine Haare, die längst mal wieder einen Schnitt nötig gehabt hätten, ziemlich wirr vom Kopf standen, weil sie vorhin vor lauter Anstrengungen, aus der wilden Schlucht herauszukommen, klatschnass geworden waren, musste er allerdings schon früher registriert haben. Alles in allem dürfte ich einen ziemlich abgerissenen Eindruck auf ihn gemacht haben – kein Wunder, dass er sich insgeheim wohl fragte, ob ich nicht doch etwas mit der Leiche zu tun hätte.
»Und dann sind Sie also da unten gelandet.« Der Polizist zeigte auf die Stelle, an welcher der Bach, dem ich gefolgt war, in die Goldach mündete.
»Ja. Und da wusste ich auch, dass ich jetzt in Sicherheit war. Ich turnte von Stein zu Stein und überquerte so die Goldach. Von dort, das wusste ich, konnte ich leicht dem Bach ein paar hundert Meter abwärts folgen, um auf den nächsten Weg zu stoßen. Oder, etwas mühsamer, den Hang zur kleinen Straße hinaufklettern, die von der Hauptstraße zur Bleichimüli führt. Vorher aber habe ich mich nach links in Richtung Brücke gewandt. Wo ich schon mal da war, konnte ich noch ein paar Bilder von der Brücke von unten aufnehmen, das sieht immer eindrucksvoll aus.«
Ich zeigte ihm die Stelle, bis zu der ich gegangen war. Eigentlich hatte ich ja die Idee gehabt, unter der Brücke hindurch zu gehen, doch das wäre nur auf einem schmalen, abschüssigen Sims möglich gewesen, auf dem ich leicht hätte abrutschen können – und von nassen Füssen hatte ich für diesen Tag genug. Ich hatte mich schon zur Rückkehr gewendet, als ich mich noch einmal umblickte. Direkt unter der Brücke bildete der Bach einen offenkundig ziemlich tiefen Tümpel, in dem das Wasser ruhig, aber für meine Blicke undurchdringlich schwarz lag. Für einen Moment sandte eine Reflexion von irgendwas einen Lichtstrahl auf diesen Tümpel und erhellte ihn an einer Stelle einige Zentimeter weit in die Tiefe. Und da sah ich sie dann: Die bleiche Hand, die mir, von schwachen Wellen bewegt, sanft zuzuwinken schien.
All das erzählte ich dem Polizisten, wenngleich etwas weniger dramatisch, denn ich glaube nicht, dass er einen Sinn für Dramatik besitzt. Wie dem auch sei. Er stellte noch die unvermeidliche Frage, ob ich irgendetwas am Fundort verändert hätte, die ich ebenso unvermeidlich verneinte:
»Nein, ich habe natürlich sofort die Polizei angerufen. Und Sie waren ja dann auch sehr schnell da.«
Das Kompliment schien den Polizisten zu freuen. Sein Miene hellte sich etwas auf, als er mir eine letzte Frage stellte: »Ist Ihnen irgend etwas Verdächtiges aufgefallen?«
Ich überlegte kurz und sagte dann: »Das Einzige war eine Fußspur im Sand am Rand des Baches, etwa hundertfünfzig Meter weiter oben. Ich habe mich noch darüber gewundert, dass es offenbar auch andere Verrückte gibt, die in solchen wilden Schluchten herum stiefeln. Aber wie alt die Spur war, kann ich natürlich auch nicht sagen, und ich fürchte, ich bin mit meinen eigenen Schuhen in die Spur hinein getreten.«
»Dann nehmen Sie bitte morgen bei der Protokollabnahme Ihre Schuhe mit, die Sie jetzt tragen, damit wir Ihre Spuren identifizieren können.« Damit war ich entlassen, mit Verdacht, wie ich fürchtete. Ich nahm den Weg hangaufwärts, was mir noch einmal etliche Schweißtropfen entlockte. Oben angekommen stellte ich fest, dass mich die Ereignisse so viel Kraft gekostet hatten, dass ich keinerlei Lust mehr verspürte, mich die ganzen dreihundert Höhenmeter hinauf nach Wald zu Fuß zu quälen. Gott sei Dank gibt es ganz in der Nähe der Brücke eine Haltestelle des Postbusses, der von Trogen über Wald nach Heiden führt. Und ein glücklicher Zufall wollte es, dass der nur stündlich verkehrende Bus in ein paar wenigen Minuten an der Haltestelle vorbei kommen würde.
Die Beschriftung der Haltestelle erinnerte mich daran, dass die offizielle Bezeichnung der Gegend nicht mundartlich „Bleichi“ ist, sondern hoch-deutsch „Bleiche“. So wurde sie auch bei der Durchsage im Postbus angekündigt, was mich einmal, als ich das im Bus sitzend hörte, zur Idee animierte, einen Krimi zu schreiben: Eine Leiche in der Bleiche.
Von der nächsten Haltestelle rauf bis zum Gipfel des Hügels, auf dem ich in einem kleinen Häuschen lebe, dauert der Fußmarsch immer noch fast eine halbe Stunde, und so hatte ich reichlich Gelegenheit, darüber nachzusinnen, dass aus dieser Schnapsidee blutiger Ernst geworden war. Jetzt gab es tatsächlich eine Leiche in der Bleiche, und blutig war sie auch, so viel hatte ich noch gesehen, als sie während meiner Einvernahme durch den Polizisten auf einer Bahre abtransportiert wurde.
Zuhause angekommen wusch ich als erstes meinen verdreckten Schuh gründlich und steckte die Hose gleich in die Waschmaschine. Dann lud ich die Bilder des Tages von meiner leicht beschädigten Kamera auf meinen Mac und sah sie mir in Groß an. Unter den Aufnahmen von den Kälbern waren wirklich ein paar gelungene, während ich in der wilden Schlucht vor lauter Anstrengung kaum zum Photographieren gekommen war. Die Bilder der Brücke von unten entsprachen meinen Erwartungen.
Hingegen bewahrheiteten sich bei den Bildern vom Tümpel unter der Brücke meine Befürchtungen. Ich hatte natürlich versucht, einen heißen Schnappschuss zu machen, der sich für gutes Geld verkaufen ließe – authentische Bilder von Wasserleichen ziehen immer. Nur sah man auf den meisten Bildern gar nichts, und das einzige, was einigermaßen viel versprechend erschien, erwies sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als Niete. Mit viel Phantasie konnte man bei größtmöglicher Vergrößerung so etwas wie eine Hand erkennen, doch bei kritischer Betrachtung wirkte das alles nur wie ein bedeutungsloser Haufen von Pixels, ähnlich den berühmten „Aufnahmen“ des Monsters von Loch Ness. Nein, so gut es meiner Kasse getan hätte, mit diesem Bild war kein Staat und schon gar keine Kohle zu machen.
Dennoch brachte das Betrachten dieses Bildes meine ganzen Gefühle noch einmal so richtig in Wallung. Ich wusste ja, dass eine Leiche da gewesen war, und wer hat schon gerne unheimliche Begegnungen der dritten Art mit einer Leiche? Ich werde jedenfalls in dieser Nacht vermutlich schlecht schlafen.